Restriktive Foren
Thema:
eröffnet von prallbeutel am 25.12.17 11:42
letzter Beitrag von prallbeutel am 08.08.23 19:00
| 1. Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 25.12.17 11:42 |
| 2. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 26.12.17 15:11 |
| 3. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von Gummimike am 29.12.17 00:29 |
| 4. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 01.01.18 13:11 |
| 5. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von Gummimike am 01.01.18 18:19 |
| 6. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 07.01.18 12:03 |
| 7. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 12.01.18 19:00 |
| 8. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 21.01.18 11:16 |
| 9. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 26.01.18 19:40 |
| 10. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 30.01.18 20:37 |
| 11. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 03.02.18 20:50 |
| 12. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 17.02.18 19:39 |
| 13. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 04.03.18 18:22 |
| 14. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 11.03.18 20:05 |
| 15. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 26.03.18 16:54 |
| 16. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 08.04.18 18:52 |
| 17. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 08.04.18 20:48 |
| 18. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 22.04.18 20:00 |
| 19. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 22.04.18 21:22 |
| 20. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 06.05.18 19:51 |
| 21. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 06.05.18 20:19 |
| 22. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 20.05.18 19:30 |
| 23. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 09.06.18 13:02 |
| 24. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 10.06.18 16:27 |
| 25. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 10.06.18 18:21 |
| 26. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 18.07.18 20:04 |
| 27. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 18.07.18 21:18 |
| 28. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 19.07.18 12:16 |
| 29. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 03.08.18 19:35 |
| 30. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 11.08.18 18:43 |
| 31. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 31.08.18 17:01 |
| 32. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 01.09.18 21:12 |
| 33. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 15.09.18 14:59 |
| 34. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 17.09.18 22:30 |
| 35. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 04.10.18 18:30 |
| 36. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 05.10.18 12:59 |
| 37. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 09.10.18 16:37 |
| 38. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 15.10.18 18:52 |
| 39. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 17.10.18 18:29 |
| 40. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 21.10.18 16:02 |
| 41. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 21.10.18 20:12 |
| 42. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 21.10.18 22:18 |
| 43. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 03.11.18 18:38 |
| 44. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 05.11.18 21:20 |
| 45. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 30.11.18 18:00 |
| 46. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 02.12.18 21:27 |

| 47. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 05.12.18 19:13 |
| 48. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 20.12.18 19:07 |
| 49. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 22.12.18 17:32 |
| 50. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 18.01.19 18:20 |
| 51. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 17.02.19 21:14 |
| 52. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 19.02.19 18:46 |
| 53. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 28.02.19 20:58 |
| 54. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 01.05.19 20:08 |
| 55. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 11.05.19 18:58 |
| 56. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 12.05.19 00:00 |

| 57. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 24.05.19 18:13 |
| 58. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 02.06.19 17:28 |
| 59. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 08.06.19 12:33 |
| 60. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 10.06.19 23:51 |
 Herzlichen Dank mal wieder!
Herzlichen Dank mal wieder!| 61. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 15.06.19 19:43 |
| 62. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 07.07.19 10:18 |
| 63. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 17.07.19 00:46 |

| 64. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 20.07.19 18:04 |
| 65. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 27.07.19 18:53 |
| 66. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 18.08.19 15:22 |
| 67. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 15.09.19 16:41 |
| 68. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 21.09.19 10:53 |
| 69. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 05.10.19 18:03 |
| 70. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 21.10.19 19:17 |
| 71. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 06.11.19 21:33 |

| 72. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 13.11.19 20:06 |
| 73. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 23.11.19 17:13 |
| 74. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 31.12.19 14:50 |
| 75. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 02.01.20 23:15 |

| 76. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 21.01.20 19:10 |
| 77. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 21.01.20 19:58 |
| 78. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 11.02.20 18:53 |
| 79. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 12.02.20 19:01 |

| 80. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von Grinser am 13.02.20 22:47 |
Zitat Hallo Prallbeutel,
vielen Dank für die Fortsetzung. Ich habe mir die 1. Ausgabe zu Gemüte geführt und fand sie gigantisch. Was mir vielleicht noch besser gefallen hätte, wenn sich Leda mit dem Volk mit dem Schießpulver verbündet hätte. Auch hätte ich mir vielleicht auch ein glücklicheres Ende von Leda und Abas gefallen, aber vielleicht fällt dir ja bei der überarbeitung noch was ein. Falls nicht machts auch nichts es ist deine Geschichte und mir hat sie trotz allem was die Helden aushalten mussten super gut gefallen. Bitte mach bald eiter.
Lg Alf
| 81. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 23.02.20 19:25 |
| 82. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 01.03.20 17:58 |
| 83. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 26.03.20 18:46 |
| 84. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 28.03.20 20:27 |
| 85. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 29.03.20 21:25 |
| 86. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 30.03.20 18:03 |
| 87. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 04.04.20 18:18 |
| 88. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 15.04.20 19:29 |
| 89. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 25.04.20 16:54 |
| 90. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 23.05.20 20:08 |
| 91. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 31.05.20 16:27 |
| 92. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 01.06.20 13:14 |

| 93. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 02.06.20 19:05 |
| 94. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 07.06.20 17:14 |
| 95. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 07.06.20 17:15 |
| 96. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 14.06.20 14:11 |
| 97. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 21.06.20 16:26 |
| 98. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 28.06.20 16:17 |
| 99. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 05.07.20 16:28 |
| 100. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 12.07.20 17:08 |
| 101. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 26.07.20 16:51 |
| 102. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 28.07.20 00:41 |

| 103. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 29.07.20 19:29 |

| 104. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 29.07.20 21:48 |
| 105. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 02.08.20 12:54 |
| 106. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 13.09.20 15:14 |
| 107. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 15.09.20 18:25 |

| 108. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 17.09.20 20:28 |
| 109. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 26.09.20 18:50 |
| 110. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 11.10.20 13:41 |
| 111. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 11.10.20 18:33 |
 Einfach Klasse!!
Einfach Klasse!!| 112. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 18.10.20 16:08 |
| 113. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 24.10.20 16:52 |
| 114. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 08.11.20 15:12 |
| 115. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 21.11.20 13:09 |
| 116. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 07.12.20 20:16 |
| 117. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 19.12.20 13:15 |
| 118. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 20.12.20 19:57 |
| 119. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 23.12.20 19:43 |
| 120. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 23.12.20 19:45 |
| 121. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 23.12.20 21:31 |
| 122. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 01.01.21 13:10 |
| 123. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 10.01.21 16:31 |
| 124. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 24.01.21 15:39 |
| 125. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 31.01.21 17:37 |
| 126. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 04.02.21 13:11 |
| 127. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 14.02.21 16:47 |
| 128. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 26.02.21 18:05 |
| 129. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 10.03.21 20:09 |
| 130. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 16.03.21 17:46 |
| 131. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 17.03.21 17:42 |
| 132. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 27.03.21 18:04 |
| 133. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 11.04.21 16:05 |
| 134. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 18.04.21 15:57 |
| 135. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 25.04.21 16:21 |
| 136. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 02.05.21 17:14 |
| 137. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 02.05.21 21:22 |
| 138. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 08.05.21 18:04 |
Zitat Hallo Prallbeutel,
vielen Dank für die super tolle Geschichte.
GVG Alf
| 139. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 08.05.21 18:05 |
| 140. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 15.05.21 19:06 |
| 141. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 21.05.21 00:52 |
| 142. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 22.05.21 13:15 |
Zitat Wie immer hervoragend! Man kann dich nicht genug loben! Herzlichen Dank wieder einmal für die Fortsetzung !
Grüße Christian
| 143. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von onkelb am 22.05.21 15:12 |
| 144. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 23.05.21 13:06 |
| 145. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 29.05.21 16:02 |
| 146. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 30.05.21 11:44 |
| 147. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 30.05.21 15:21 |

| 148. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 03.06.21 12:04 |
| 149. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 06.06.21 13:13 |
| 150. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 13.06.21 13:43 |
| 151. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 20.06.21 16:12 |
| 152. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 27.06.21 19:26 |
| 153. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 04.07.21 12:36 |
| 154. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 14.07.21 18:39 |
| 155. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 14.07.21 20:54 |
| 156. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 24.07.21 13:15 |
| 157. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 31.07.21 15:47 |
| 158. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 31.07.21 22:14 |


| 159. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 08.08.21 13:43 |
| 160. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 10.08.21 10:55 |

| 161. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 20.08.21 17:00 |
| 162. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von M A G N U S am 21.08.21 05:19 |
| 163. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 22.08.21 20:25 |



| 164. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 28.08.21 13:32 |
| 165. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 05.09.21 13:00 |
| 166. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 12.09.21 13:33 |
| 167. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 25.09.21 13:05 |
| 168. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 03.10.21 13:21 |
| 169. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 04.10.21 13:01 |
 - so zu geht.....Herzlichen Dank wieder einmal...
- so zu geht.....Herzlichen Dank wieder einmal...| 170. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 04.10.21 19:57 |
| 171. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 10.10.21 16:16 |
| 172. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage), Kommentar: | geschrieben von M A G N U S am 11.10.21 22:28 |
| 173. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 16.10.21 16:11 |
| 174. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 18.10.21 18:48 |

| 175. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 23.10.21 16:00 |
| 176. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 24.10.21 11:41 |
| 177. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 31.10.21 14:48 |
| 178. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 06.11.21 13:11 |
| 179. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 06.11.21 19:52 |



| 180. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 13.11.21 13:51 |
| 181. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 20.11.21 13:03 |
| 182. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 27.11.21 13:00 |
| 183. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 04.12.21 17:21 |
| 184. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 10.12.21 15:55 |
| 185. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von M A G N U S am 10.12.21 20:20 |
| 186. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 10.12.21 21:48 |
| 187. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von aspangaw am 11.12.21 10:49 |
| 188. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 12.12.21 18:43 |

| 189. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 17.12.21 16:11 |
| 190. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 01.01.22 19:50 |
| 191. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 03.01.22 18:23 |
| 192. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von M A G N U S am 03.01.22 21:56 |
| 193. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 04.01.22 19:47 |
 ...... )
...... )
| 194. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 07.01.22 21:29 |
| 195. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 07.01.22 21:33 |
| 196. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 15.01.22 15:38 |
| 197. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 28.01.22 21:00 |
| 198. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 20.02.22 18:35 |
| 199. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 22.03.22 10:05 |
| 200. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 23.03.22 20:54 |
| 201. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 24.03.22 18:44 |

| 202. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 02.04.22 15:22 |
| 203. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 16.04.22 10:30 |
| 204. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 30.04.22 11:03 |
| 205. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von M A G N U S am 01.05.22 19:43 |
| 206. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 07.05.22 15:35 |
| 207. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 08.05.22 11:07 |


| 208. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 09.05.22 17:50 |
| 209. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 21.05.22 10:55 |
| 210. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 29.05.22 22:27 |
| 211. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 04.06.22 15:59 |
| 212. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 12.06.22 12:46 |
| 213. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 19.06.22 14:33 |
| 214. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 06.07.22 19:00 |
| 215. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von M A G N U S am 11.07.22 22:24 |
| 216. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 16.07.22 15:16 |
| 217. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 16.07.22 15:17 |
| 218. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 20.07.22 17:58 |
Zitat Nachdem ich unlängst für meine Geschichte neuerliche Anerkennung erfahren habe, möchte ich nun meinerseits nicht säumen, ein weiteres Mal meine vorzüglichste Hochachtung dem Autor dieses Romans entgegenzubringen; neben der schier unendlichen Phantasie bewundere ich den literarischen Erzählstil auf höchstem Niveau, wie offenbar geradezu spielerisch-selbstverständlich die Finger des Schriftstellers über die Tastatur fliegen und dabei perfekt die alte Sprache mit ihren archaisch anmutenden Begrifflichkeiten aufleben lassen, einzig die Anwendung der neuen Rechtschreibung beraubt die Illusion, es handelte sich um ein Werk des 19. Jahrhunderts, somit haben wir Grund zur Annahme, daß sich hinter dem Pseudonym des Prallen Beutels ein äußerts talentierter berufsmäßiger Schriftsteller verberge.
Herzlich Dank für die Mühewaltung!

| 219. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 29.07.22 20:12 |
| 220. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von M A G N U S am 31.07.22 12:57 |
| 221. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 13.08.22 02:27 |
| 222. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 14.08.22 19:17 |
| 223. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 27.08.22 16:16 |
| 224. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 04.09.22 15:41 |
| 225. RE: Literarisches Meisterwerk! | geschrieben von M A G N U S am 07.09.22 08:48 |
| 226. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 24.09.22 19:23 |
| 227. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 24.09.22 23:03 |




| 228. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von M A G N U S am 26.09.22 17:53 |
| 229. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 01.10.22 16:17 |
| 230. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 07.10.22 12:55 |
| 231. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 15.10.22 11:38 |
| 232. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 20.10.22 12:07 |
| 233. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 23.10.22 12:04 |
| 234. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 29.10.22 15:16 |
| 235. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 20.11.22 16:25 |
| 236. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 02.12.22 18:41 |
| 237. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 02.12.22 23:23 |


| 238. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 11.12.22 11:23 |
| 239. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von M A G N U S am 11.12.22 18:00 |
| 240. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 16.12.22 20:21 |
| 241. RE: Empfindsamer Schlamm | geschrieben von M A G N U S am 17.12.22 23:07 |
| 242. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 19.12.22 19:55 |
 Und auch ein Autor heißt menschliche Empfindungen wie hier dieses Feedback willkommen.
Und auch ein Autor heißt menschliche Empfindungen wie hier dieses Feedback willkommen. 
| 243. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 21.12.22 18:53 |
| 244. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 24.12.22 13:39 |
| 245. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 26.12.22 13:30 |
| 246. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 27.12.22 00:34 |
 Dazu Treidelsklaven etc...Und die Herrin , die sich auf einem der Schiffe vom Arbeitssklaven verwöhnen lässt,während draussen sich die anderen Sklaven unter der Peitsche abschuften müssen , wobei die Schiffseignerin sich durch das Klatschen der Schnüre auf die Sklavenrücken und die zweifelsohne folgenden Schreie sicher noch mehr anregen lässt....Kopfkino...
Dazu Treidelsklaven etc...Und die Herrin , die sich auf einem der Schiffe vom Arbeitssklaven verwöhnen lässt,während draussen sich die anderen Sklaven unter der Peitsche abschuften müssen , wobei die Schiffseignerin sich durch das Klatschen der Schnüre auf die Sklavenrücken und die zweifelsohne folgenden Schreie sicher noch mehr anregen lässt....Kopfkino...


| 247. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von M A G N U S am 29.12.22 06:48 |
| 248. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 29.12.22 09:45 |
| 249. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 29.12.22 13:57 |
| 250. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 31.12.22 13:07 |
| 251. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 06.01.23 19:33 |
| 252. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von M A G N U S am 09.01.23 10:00 |
| 253. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 09.01.23 19:45 |
| 254. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 15.01.23 16:06 |
| 255. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 21.01.23 13:32 |
| 256. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von M A G N U S am 22.01.23 17:44 |
| 257. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 24.01.23 13:12 |
Zitat Wilhelm Busch schreibt von dem lieben Federvieh, mit welchem sich Mancher viele Müh gäbe, und zu meiner Jugendzeit, vor 50 Jahren, sprach man vom Spannvieh, wenn keine Unterscheidung getroffen werden sollte, ob es das Pferd sei oder der Ochse, der vor das Fuhrwerk oder vor den Pflug gespannt wird; neu ist mir der Begriff des Ruderviehs, welcher hier am Anfang der vorstehenden Episode eingeführt worden ist, und wieder einmal gibt uns der Autor neben den brillanten Formulierungen eine phantasiereiche Wortneuschöpfung, Sklavenmaterial, Rudervieh, was wird noch alles auf uns zukommen!



| 258. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 24.01.23 13:31 |
| 259. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von AlfvM am 24.01.23 17:07 |
| 260. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 28.01.23 12:21 |
| 261. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 04.02.23 13:06 |
| 262. RE: "Schwärende Wunde" | geschrieben von M A G N U S am 05.02.23 13:19 |
| 263. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 19.02.23 16:59 |
| 264. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 25.02.23 16:14 |
| 265. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 26.02.23 13:37 |



| 266. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von aspangaw am 27.02.23 10:19 |
| 267. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 26.03.23 18:24 |
| 268. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von DT1ZZ am 30.03.23 11:00 |

| 269. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 02.04.23 20:00 |
| 270. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 08.04.23 18:37 |
| 271. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 23.04.23 18:02 |
| 272. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 28.04.23 15:14 |
| 273. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 06.05.23 18:27 |
| 274. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 16.05.23 19:51 |

| 275. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 21.05.23 18:24 |
| 276. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 02.06.23 19:24 |
| 277. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 02.06.23 23:00 |







| 278. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von M A G N U S am 03.06.23 19:35 |
| 279. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 04.06.23 16:17 |
Zitat ...
Die geschliffene Sprache, die mannigfaltige Verwendung archaisch anmutender Begriffe legt die Vermutung nahe, daß ein Philosoph, ein Germanistikprofessor oder ein Geschichtsgelehrter sein schriftstellerischen Können zum besten gibt, indes sehe ich mich mehr und mehr in meiner Ahnung bestärkt, daß hier jemand nicht nur sieben Weihestufen durchlaufen hatte, sondern auch die krönende achte mit der sakramentalen Licentia, unter anderem Sünden zu vergeben und das Sakrifizium zu halten, eine freilich teuer erkaufte Würde, den Beutel stets gefüllt zu lassen, so prall er auch anschwelle!
Ergebenst,
M a g n u s .

| 280. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 10.06.23 12:04 |
| 281. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 18.06.23 16:00 |
| 282. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 01.07.23 16:28 |
| 283. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 16.07.23 12:12 |
| 284. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 05.08.23 10:46 |
| 285. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von M A G N U S am 07.08.23 11:59 |
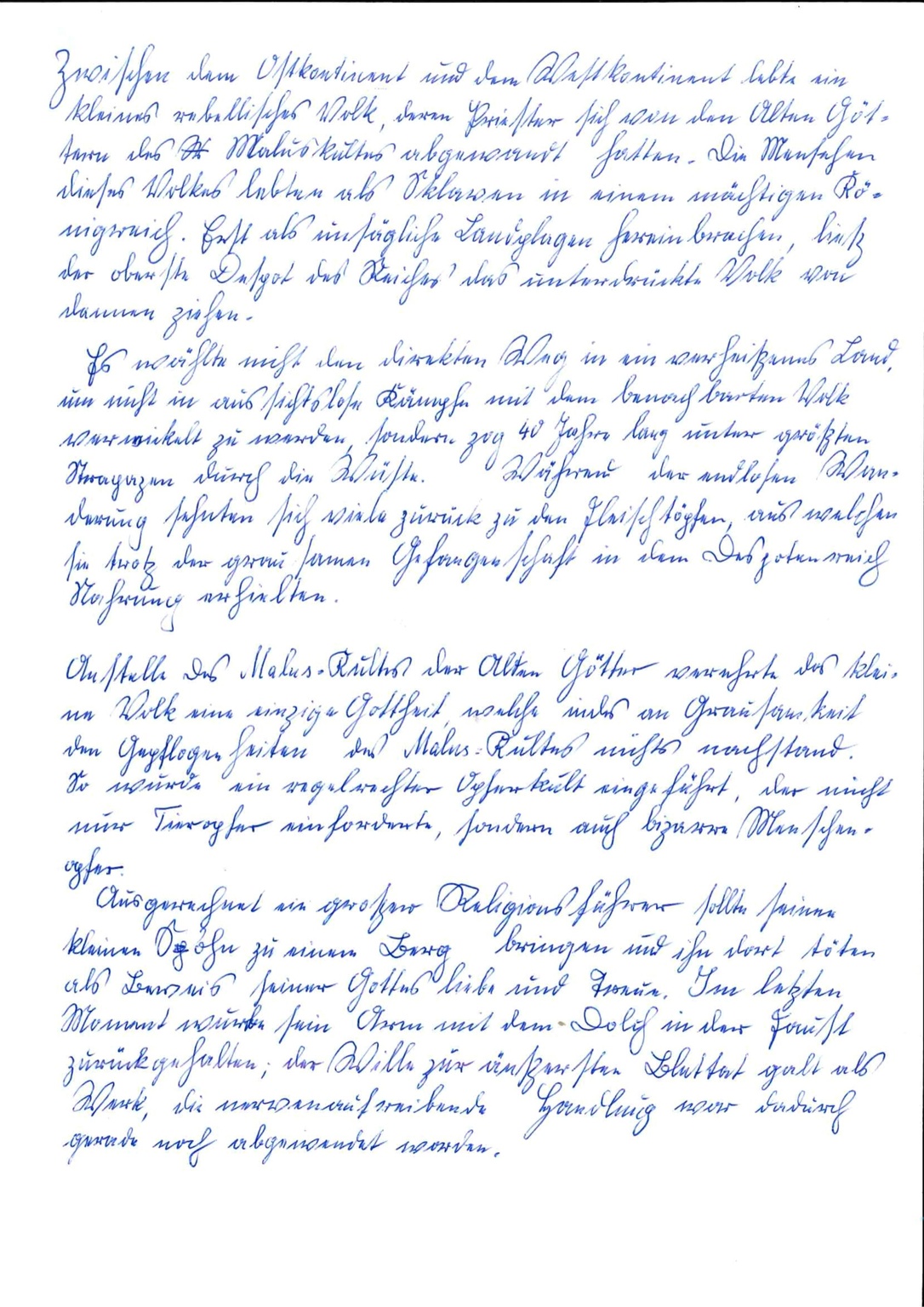
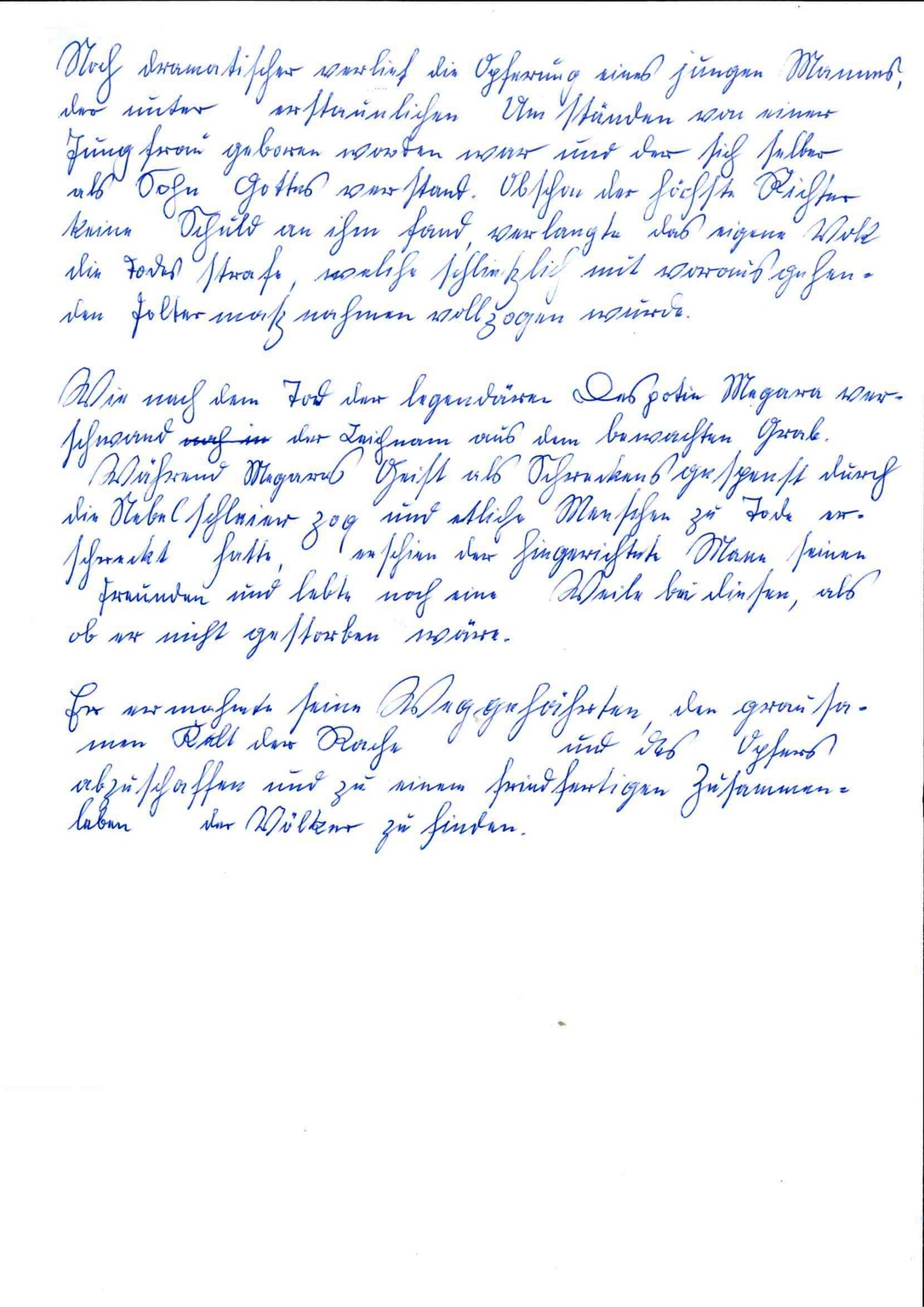
| 286. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 08.08.23 08:20 |



| 287. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von sheeeep am 08.08.23 09:36 |

| 288. RE: Das Reich der Megara (Neuauflage) | geschrieben von prallbeutel am 08.08.23 19:00 |
